Lehrende des M.Sc. Mikrobiologie
Diese Seite soll Aufschluss über die Lehrenden des Masterstudiengangs geben.Unten finden Sie eine Liste der Dozenten mit entsprechenden Kontaktinformationen, sowie einer Kurzzusammenfassung des entsprechenden Forschungsthemas.
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Prof. Dr. Martin Baunach (Juniorprofessor)
Institut für Pharmazeutische Biologie
E-mail: mbaunach@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-9397
Raum 1.019
Nussallee 2
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Entdeckung und Biosynthese von Naturstoffen wie Antibiotika und G-Protein-Inhibitoren.

Dr. Oliver Caspari
Institut für Mirkobiologie und Biotechnologie
E-mail: caspari@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-8261
Raum U.042
Meckenheimer Allee 168
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Die AG Caspari beschäftigt sich mit der Erforschung der Biogenese und Aufrechterhaltung der Photosynthese anhand der Modell-Grünalge Chlamydomonas reinhardtii. Im Rahmen dessen wird untersucht, wie die Photosynthesemaschinerie generiert wird (beginnend mit dem Proteinimport in den Chloroplasten) und wie der Abbau in alternden Kulturen verhindert werden kann. Das Forschungsziel ist die biotechnologische Nutzung stabiler Photosynthesekulturen zu ermöglichen.

Priv. Doz. Dr. Christiane Dahl
Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie
E-mail: ChDahl@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-2119
Fax: +49 228 73-7576
Raum 0.001
Meckenheimer Allee 168
53115 Bonn
Die Umsetzung von Schwefelverbindungen ist eine der ältesten biologischen Strategien zur Energiekonservierung und auch heute sind schwefelmetabolisierende Prokaryoten von immenser Bedeutung für den biogeochemischen Schwefelkreislauf. Unser Fokus liegt auf der Untersuchung des oxidativen Schwefelstoffwechsels in Bakterien, mit Schwerpunkt auf der biochemischen, biophysikalischen und strukturellen Charakterisierung der beteiligten Enzyme. Viele davon sind komplexe Metalloproteine, deren Bearbeitung spezielle Techniken wie den kompletten Ausschluss von Sauerstoff erfordern. Zudem entwickeln wir für Modellorganismen Methoden zur Genmanipulation und verfolgen systembiologische Ansätze (Genomics, Transcriptomics, Proteomics und Metabolomics).

Prof. Dr. Uwe Deppenmeier
Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie
E-mail: udeppen@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-5590
Raum 2.022
Meckenheimer Allee 168
53115 Bonn
Forschungsschwerpunkte: Physiologie und Biochemie der wichtigsten Vertreter der humanen Darmmikrobiota,
mikrobielle Produktion von Succinat als Plattformchemikalie aus nachwachsenden Rohstoffen,
mikrobielle Produktion von Präbiotika und kalorienarmen Süßungsmitteln

Prof. Dr. Ulrike Endesfelder
Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie
E-mail: endesfelder@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-2320
Raum 3.001
Meckenheimer Allee 168
53115 Bonn
Uns interessiert wie zelluläres Leben durch molekulare Prozesse entsteht und gesteuert wird. Als interdisziplinäre Gruppe mit einem Forschungsfokus auf der mikrobiellen Zellbiologie verwenden wir eine umfassende Palette von Methoden, darunter Molekularbiologie, Biochemie, Bioanalytik, Fluoreszenzmikroskopie, Biophysik und computergestützte Ansätze. Eine Besonderheit ist unser methodischer Schwerpunkt auf quantitativer Mikroskopie, insbesondere der Einzelmolekülmikroskopie, um die Zellbiologie verschiedenster Mikroorganismen aus allen Domänen des Lebens - Archaeen, Eukaryoten sowie Prokaryoten - zu untersuchen. Dadurch können wir die Wechselwirkungen und Funktionen einzelner molekularer Akteure innerhalb der zellulären Umgebung visualisieren und messen. Die direkte Beobachtung des komplexen molekularen Lebens ermöglicht uns wichtige Einblicke und ein grundlegendes Verständnis der Zellbiologie und Physiologie der Mikroorganismen zu erhalten.

Prof. Dr. Albert Haas
Institut für Zellbiologie
E-mail: ahaas@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-6340
Raum 0.012
Ulrich-Haberland-Str. 61A
53121 Bonn
Was passiert, nachdem ein Mikroorganismus von einer Immunfreßzelle aufgenommen wurde? Wie wird er getötet und verdaut? Wie arbeiten intrazelluläre Kompartimente der Säugerzelle in diesem Prozeß zusammen? Und wie kann ein intrazelluläres Pathogen diese Säugerzelle, die es eigentlich umzubringen müsste, so umprogrammieren, dass sich das Pathogen letztlich in ihr sogar vermehrt? Wir untersuchen das vorwiegend mit mikroskopischen, biochemischen, klassisch mikrobiologischen und molekulargenetischen Methoden. Unser Hauptmodell ist Rhodococcus equi, ein Gram-positives Bakterium, dass vor allem Fohlen-, aber auch Humanmakrophagen befällt, und schwere Pneumonien auslösen kann.

Dr. Katharina Scherer
Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie
E-mail: k.scherer@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-8266
Raum U.041
Meckenheimer Allee 168
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Viren (va. Reproduktion) erschließen über hochauflösende Lichtmikroskopie
Landwirtschaftliche Fakultät
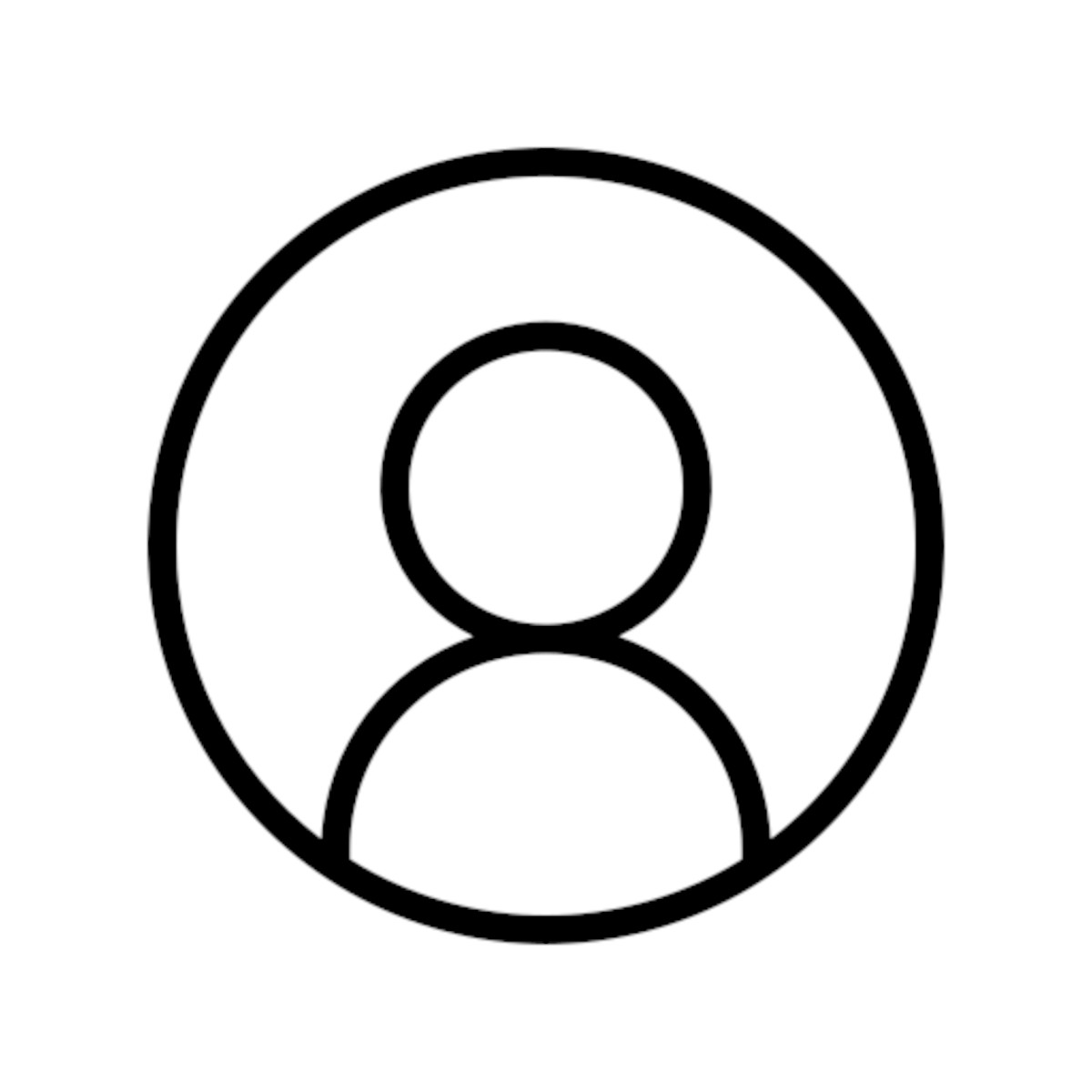
Dr. Mareike Baer (geb. Winter)
Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
E-mail: mabaer@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-7754
Raum 0.012
Friedrich-Hirzebruch-Allee 7
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene

Prof. Dr. Armin Djamei
Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz
E-mail: djamei@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-3339
Raum 1.010
Nußallee 9
53115 Bonn
Schwerpunkt der Professur Pflanzenpathologie ist die zellbiologische, genetische und molekulare Erforschung der biogenen Ursachen, die bei Pflanzen zu Krankheiten führen. Aufbauend auf diesem Verständnis der Krankheitsursachen werden Strategien entwickelt, Nutzpflanzen vor Krankheiten zu schützen. Das Hauptaugenmerk liegt dabeiauf phytopathogenen Pilzen und Oomyceten in ihrer Interaktion mit deren jeweiligen Wirtspflanzen. Desweiteren werden wissenschaftliche Pflanzenmodelle wie Arabidopsis thaliana und Nicotiana benthamiana in der Forschung verwendet, die der Erweiterung des Grundlagenwissens über das pflanzliche Immunsystem dienen und experimentell und genetisch leicht zugänglich sind.
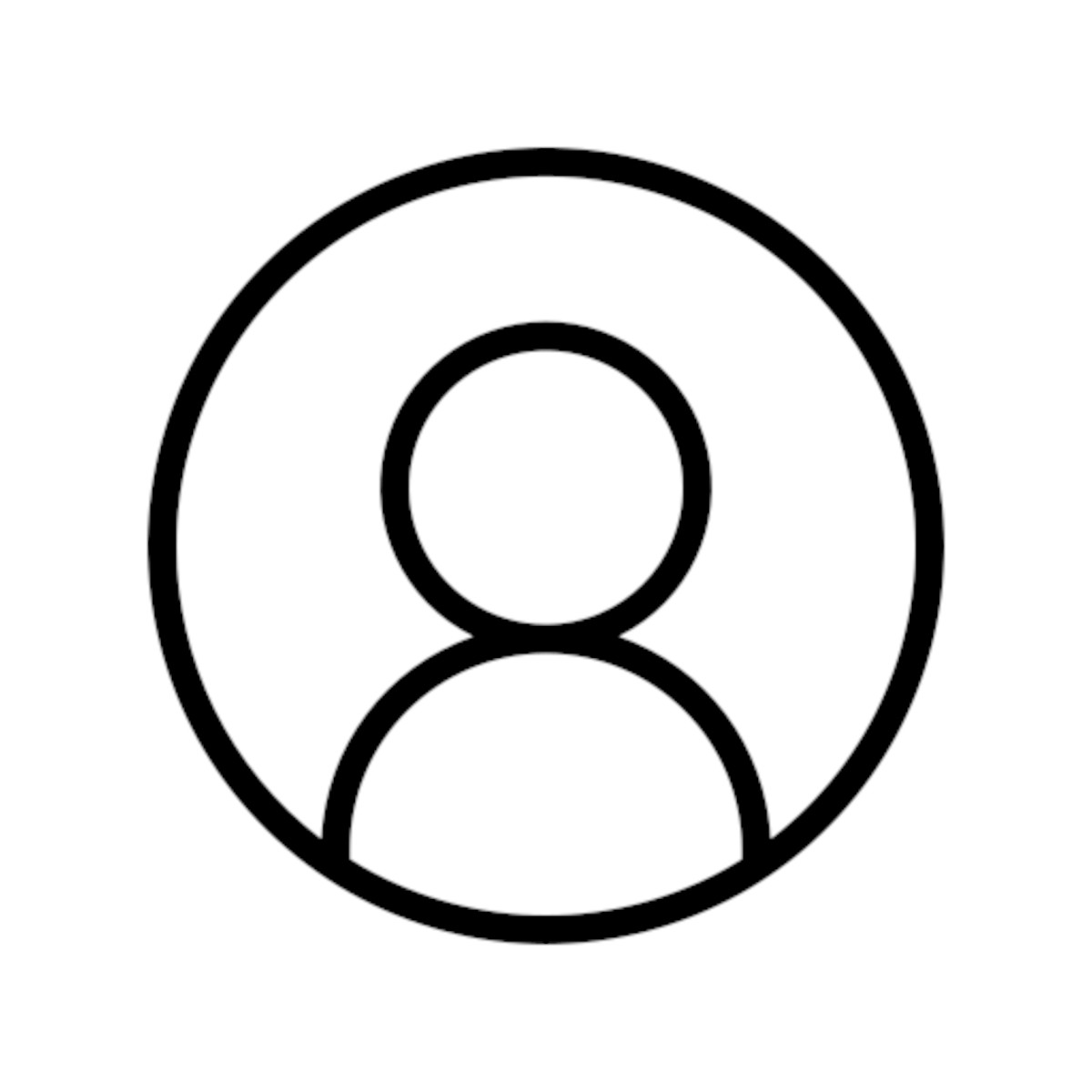
Dr. Katharina Frindte
Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz
E-mail: kfrindte@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-2979
AG Molekularbiologie der Rhizosphäre
Nußallee 13
53127 Bonn
Forschungsgebiet: Einfluss von Veränderungen der Bodenfeuchte, Bodentemperatur und der Landnutzung mikrobielle Gemeinschaften im Boden und auf Pflanzenwurzeln

Priv. Doz. Dr. Joachim Hamacher
Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz
E-mail: hamacher@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-2456
Remise Souterrain
Nussallee 9
53115 Bonn
Dr. J. Hamacher leitet das Agro-Horti-Testlabor in den Räumlichkeiten der Universität und in Kooperation mit dieser, dem Pflanzenschutzamt in Köln und der Deutschen Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) in Braunschweig: die Schwerpunkte liegen auf der Routinediagnose von Pflanzenviren mithilfe serologischer und elektronenmikroskopischer Methoden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kultivierung von Pflanzenviren, deren Präparation durch Ultrazentrifugation zur Herstellung polyklonaler Antiseren sowie deren Aufbereitung zu ELISA-Kits.
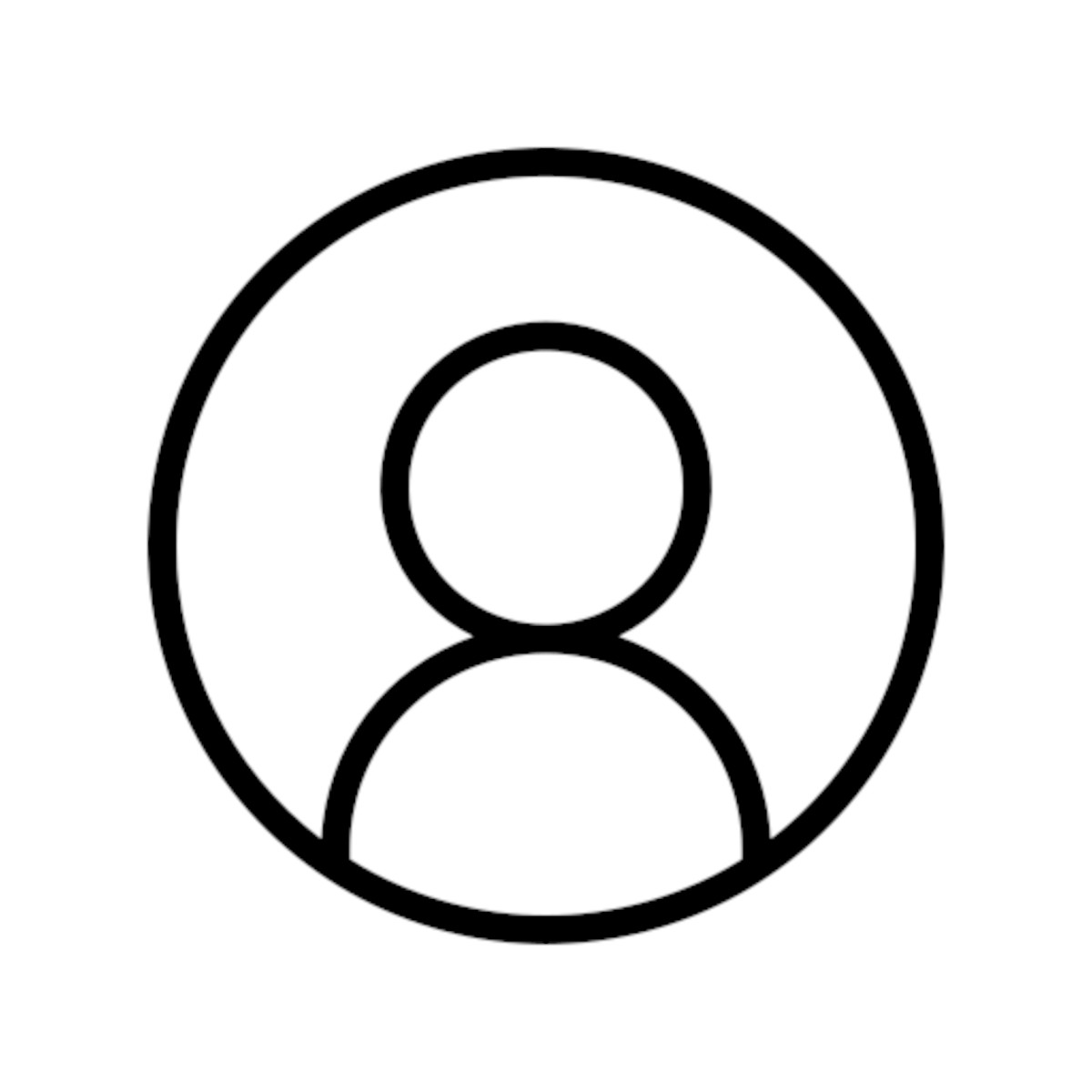
Dr. Céline Heinemann
Institut für Tierwissenschaften
E-mail: c.heinemann@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-1977
Katzenburgweg 7 - 9
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Hygiene, Rückstände und Schadstoffe bei Nutztierhaltung
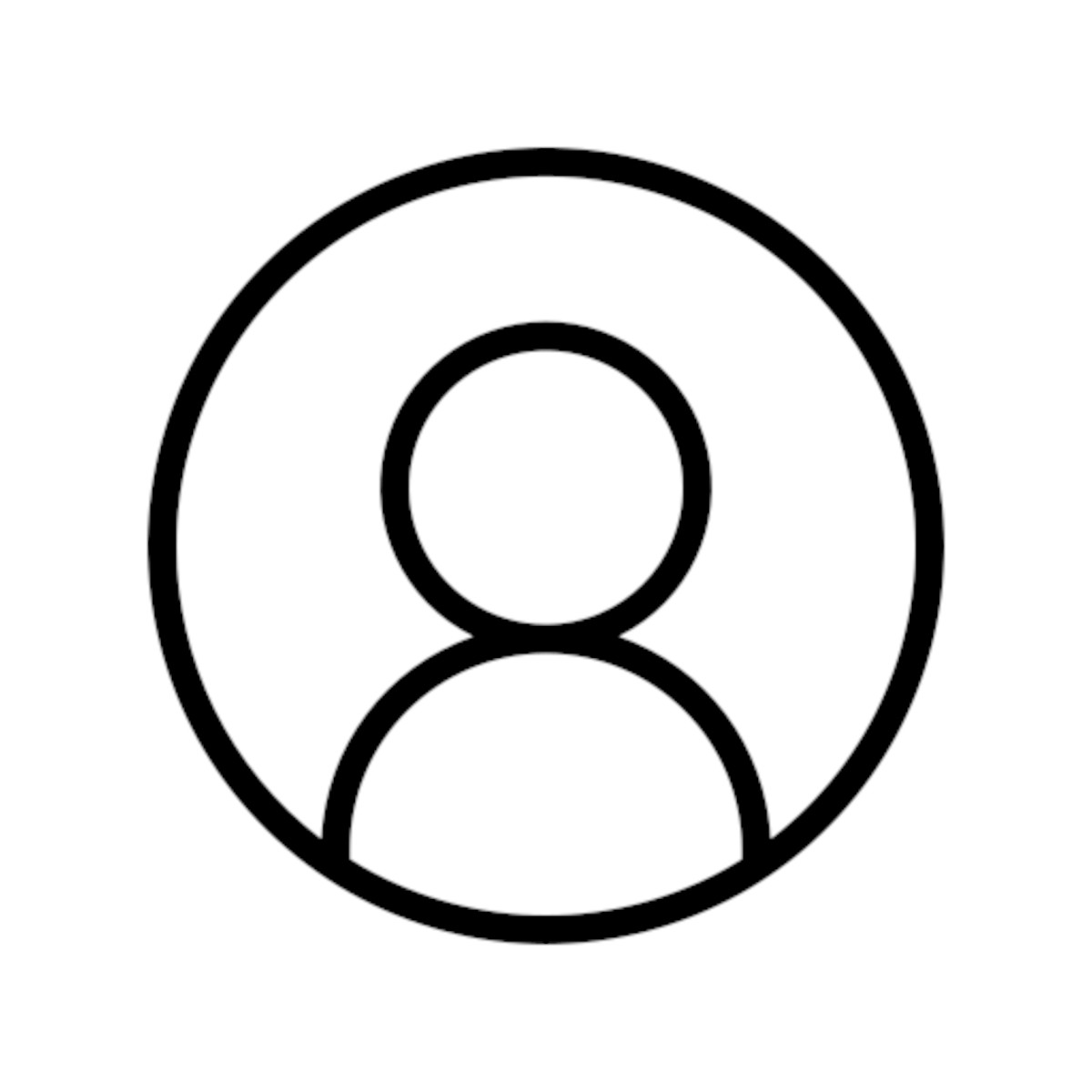
Dr. med. vet. Stephanie Hiss-Pesch
Institut für Tierwissenschaften
E-mail: s.hiss@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-2063
Katzenburgweg 7 - 9
53115 Bonn
Forschungsgebiet:Tiergesundheit, Tierwohl und Anwendung der 3R-Prinzipien bei Versuchtieren (Tierschutzbeauftragte)

Prof. Dr. Claudia Knief
Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz
E-mail: knief@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-2555
Raum 2.008
Nussallee 13
53115 Bonn
Uns interessiert die Biologie bodenlebender und pflanzenassoziierter Mikroorganismen. Im Fokus stehen mikrobiell ökologische Fragestellungen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis zum Einfluss abiotischer und biotischer Faktoren auf das bodenlebende und pflanzenassoziierte Mikrobiom zu gewinnen. In gleicher Weise interessiert uns die Bedeutung verschiedener Arten von Mikroorganismen für die Funktionalität des Bodens und der Rhizosphäre. Eine bessere Kenntnis der mikrobiellen Prozesse und der Faktoren, die diese beeinflussen, trägt zu einem vertieftem Ökosystemverständnis bei, entscheidend um Nutzpflanzen nachhaltiger anzubauen und Ökosysteme zu erhalten. Methodisch kombinieren wir Feldstudien mit Laborversuchen und verwenden überwiegend molekulare Ansätze zur Analyse von Feld- und Umweltproben. Je nach Fragestellung arbeiten wir auch mit Pflanzen- und Mikroorganismenkulturen unter kontrollierten Bedienungen, um Mechanismen und Zusammenhänge aufzuklären.

Prof. Dr. André Lipski
Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
E-mail: lipski@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-5604
Raum 0.014
Friedrich-Hirzebruch-Allee 7
53115 Bonn
In unserer Abteilung werden verschiedene Fragen aus dem Bereich der Lebensmittelmikrobiologie bearbeitet. Hierzu gehört die Bildung von Biofilmen in der Lebensmittelproduktion, die Aufklärung von Kooperationsphänomenen zwischen verschiedenen Mikroorganismenpopulationen, die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in der Tierhaltung, sowie die Beschreibung von Anpassungsmechanismen von Lebensmittel-assoziierten Bakterien an niedrige Temperaturen. Weiterhin werden taxonomische Fragestellungen, wie z.B. die Neubeschreibung von Bakterienspezies insbesondere, aber nicht nur, aus dem Lebensmittelbereich behandelt.
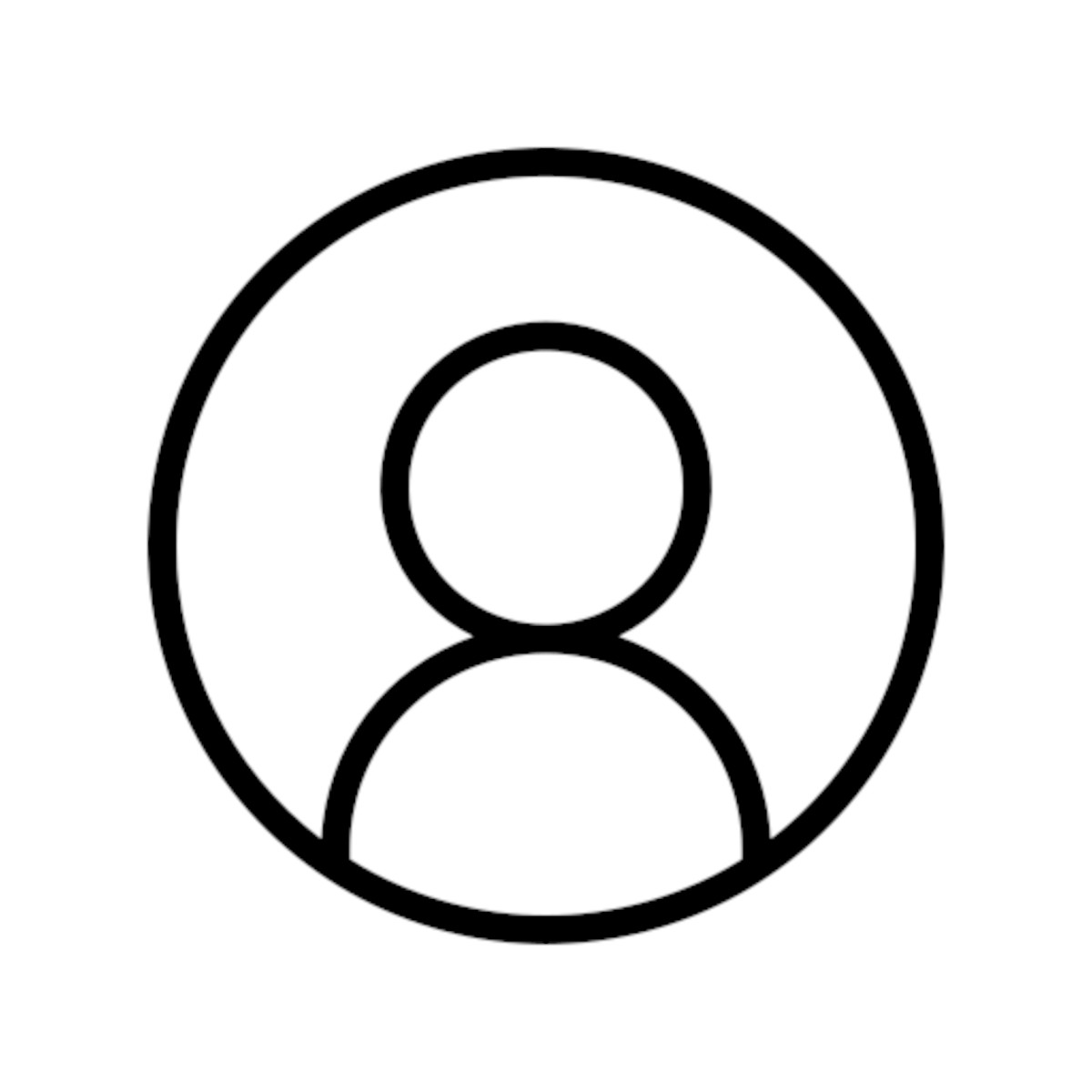
Dr. agr. Ute Müller
Institut für Tierwissenschaften
E-mail: ute-mueller@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-5112
Katzenburgweg 7 - 9
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Milchkuh Industrie
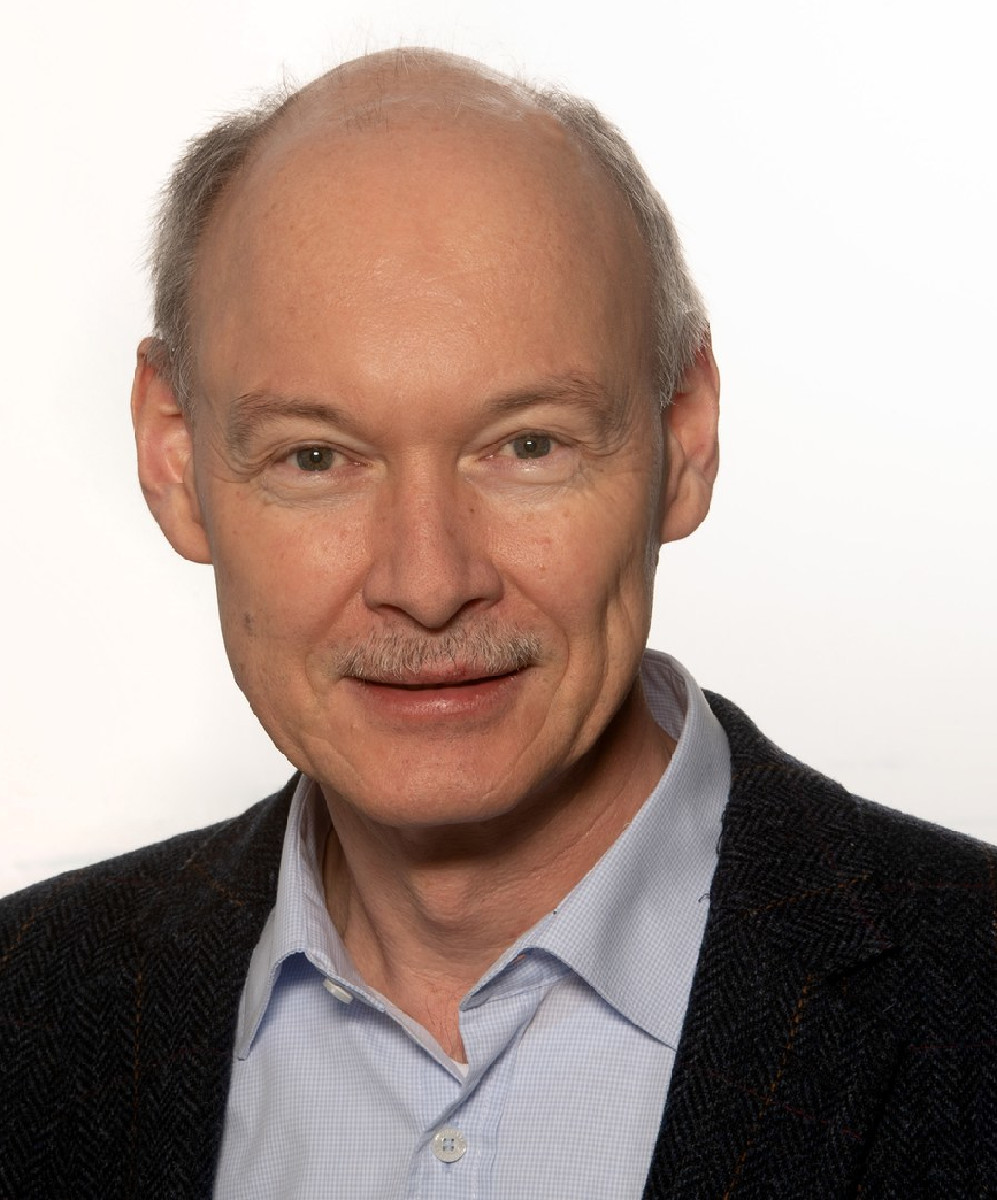
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Schieber
Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
E-mail: schieber@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-4452
Raum 1.020
Friedrich-Hirzebruch-Allee 7
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Molekulare Lebensmitteltechnologie
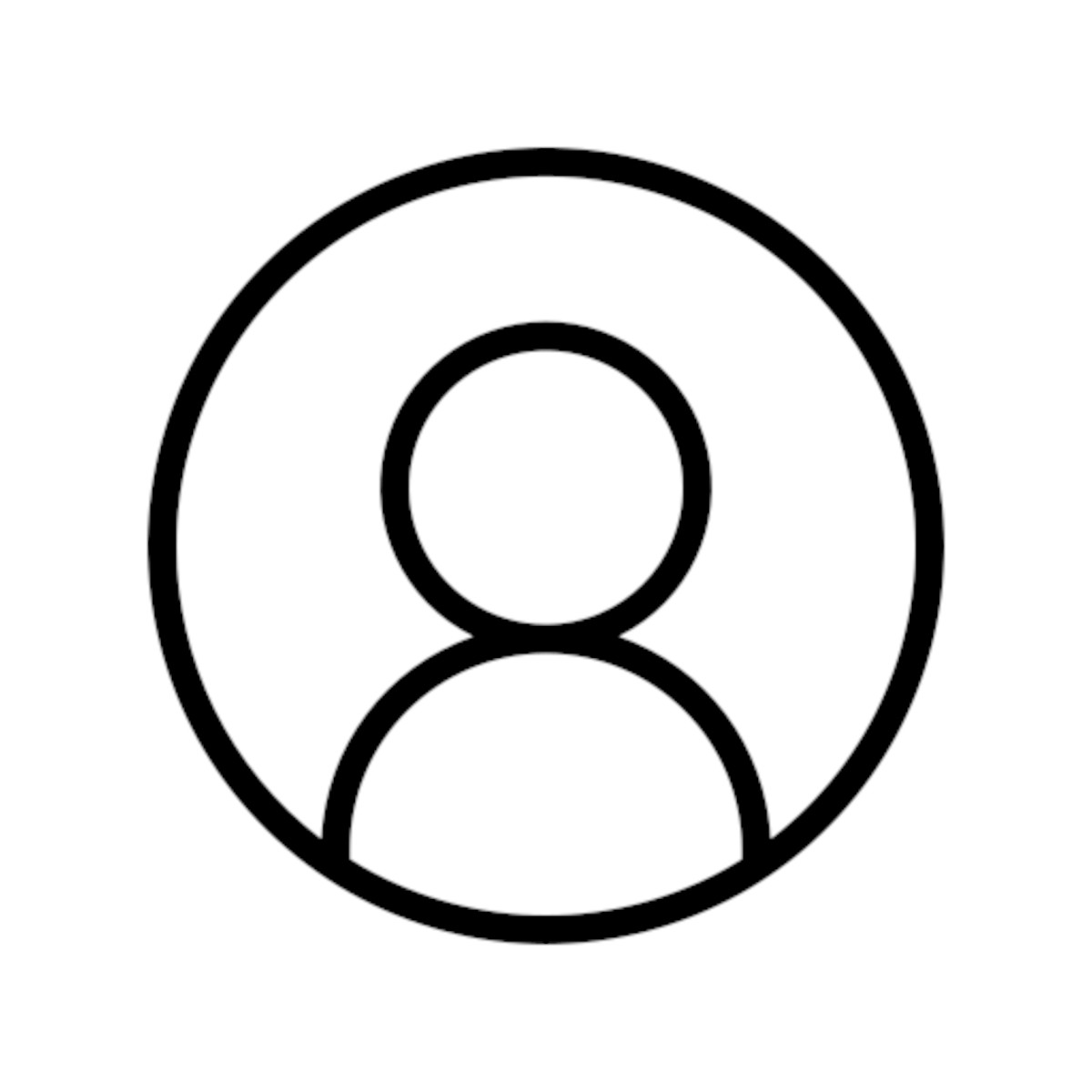
Dr. Waldemar Seel
Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
E-mail: wseel@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-2021
Friedrich-Hirzebruch-Allee 7
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Ernährung und Mikrobiota
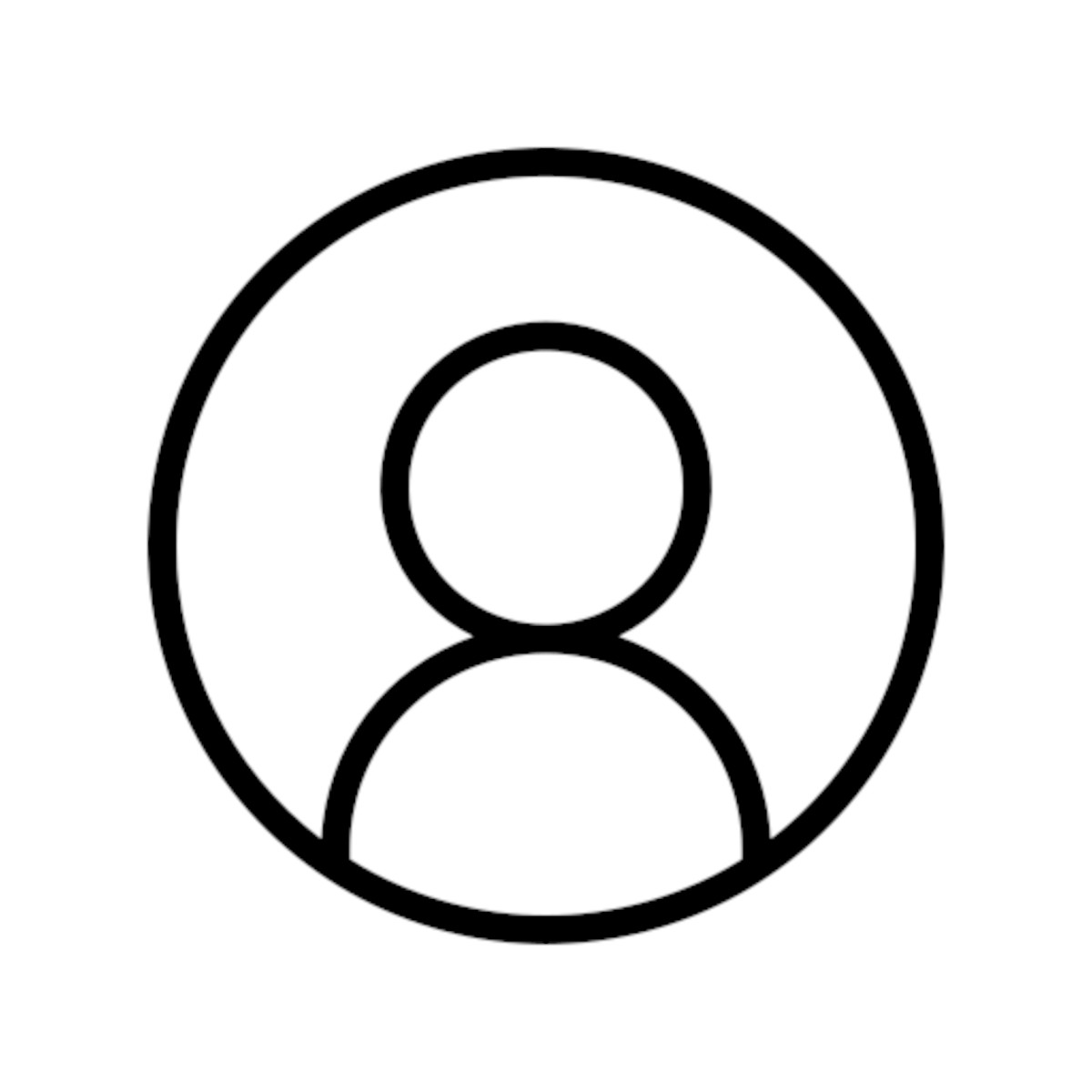
Jun-Prof. Dr. Marie-Christine Simon
Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
E-mail: marie-christine.simon@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-3814
Raum 1.014, 1. OG
Nussallee 9
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Mikrobiom, Stoffwechsel und Darm-Hirn-Schnittstelle
Medizinische Fakultät

Dr. Tomabu Adjobimey
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie (IMMIP)
E-mail: tomabuadjobi@hotmail.com
Tel.: +49 228 287-16384
Universitätsklinikum Bonn - Gebäude 63
Venusberg - Campus 1
53127 Bonn
Forschungsgebiet: Parasitisch Induzierte Immuntoleranz und deren Modulation durch Co-Infektion und/oder zusätzliche Immunaktivierung

Apl. Prof. Dr. Gabriele Bierbaum
Medizinische Mikrobiologie
E-mail: g.bierbaum@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 287-19103
Gebäude 63, 2. OG, Raum 67
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn
Die Gruppe beschäftigt sich mit beiden Seiten der Antibiotikaproblematik: Wir charakterisieren neue Antibiotika aus verschiedenen Organismen wie z. B. Staphylokokken und Bazillen, ihre Wirksamkeit und Wirkmechanismen (Cervimycin und Corallopyronin), und wir untersuchen die Mechanismen der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen. Außerdem evaluieren wir Zweikomponenten-Regulationssysteme als neue Targets für Antibiotika. Ein weiteres Augenmerk gilt der Ausbreitung von Antibiotika-resistenten Bakterien in der Umwelt und der Selektion solcher Organismen über Abwasser und die darin enthaltenen Pharmazeutika. Im Rahmen einer interdisziplinären Forschergruppe mit den Paläontologen der Universität Bonn beschäftigen wir uns mit der Rolle von Biofilmen bei der Fossilisation.
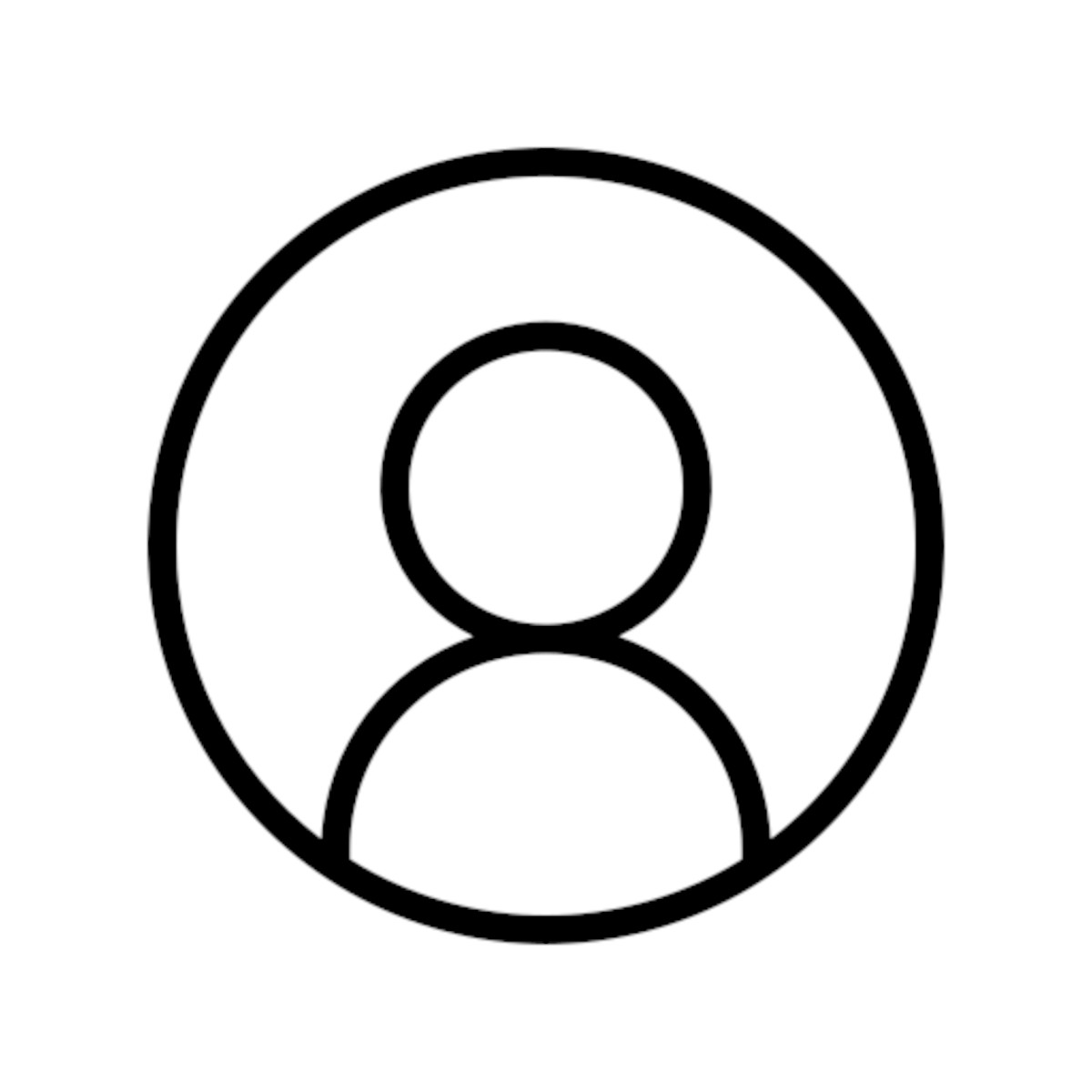
Dr. rer. nat. Beate Heinrichfriese
Institut für Pharmazeutische Mikrobiologie
E-mail: bheinrich@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-4637
Raum 15
Meckenheimer Allee 168
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Bakterielle Histidinkinasen

Prof. Dr. med. Achim Hörauf
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie (IMMIP)
E-mail: achim.hoerauf@ukbonn.de
Tel.: +49 228 287-11621
Universitätsklinikum Bonn - Gebäude 63
Venusberg - Campus 1
53127 Bonn
Forschungsgebiet: Verständnis von Filariosen durch parasiteninduzierte Immunantwort, sowie Entwicklung von Diagnoseinstrumenten und Medikamenten.

Prof. Dr. Marc Hübner
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie (IMMIP)
E-mail: huebner@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 287-19177
Universitätsklinikum Bonn - Gebäude 63
Venusberg - Campus 1
53127 Bonn
Forschungsgebiet: Tropenmedizin und Filariosen
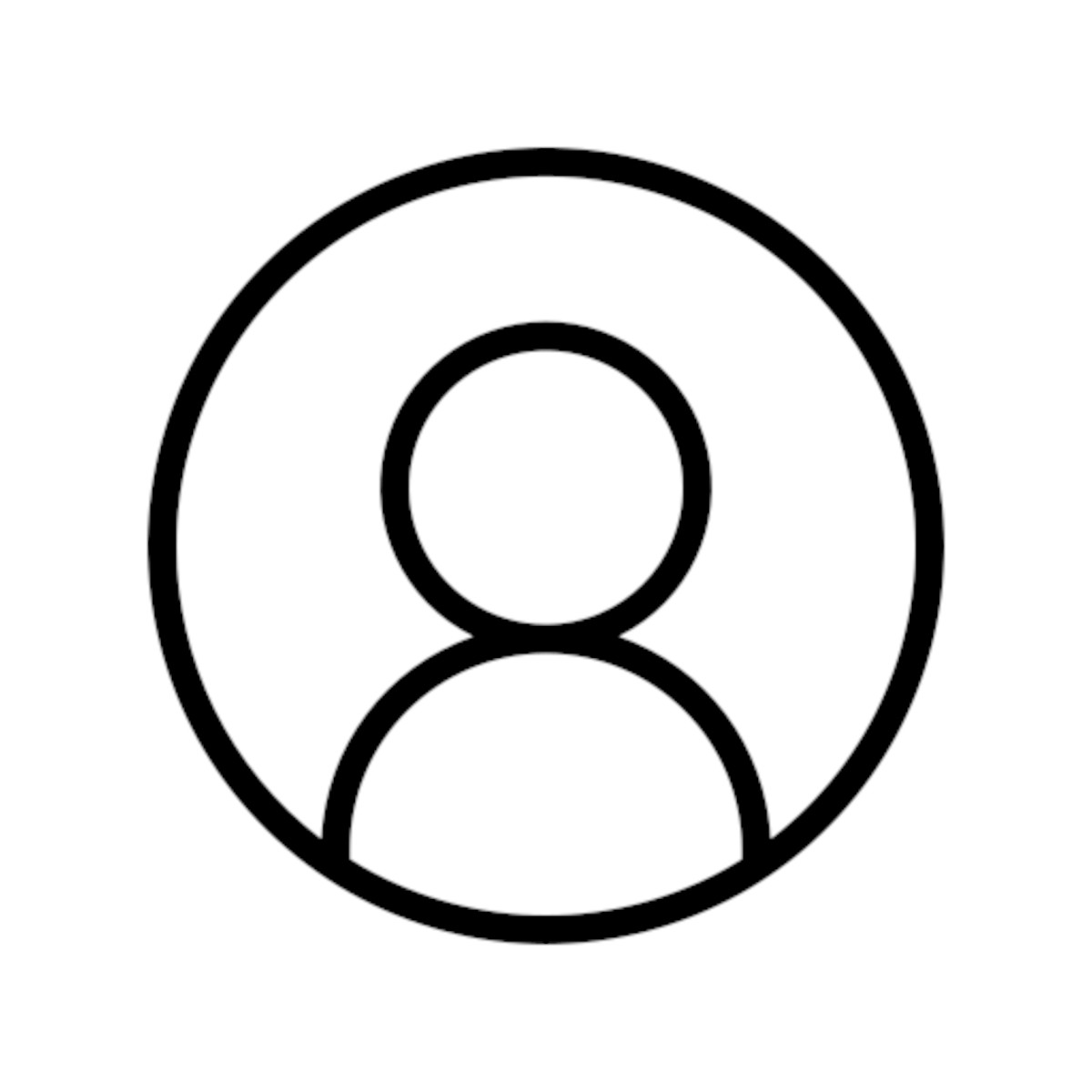
Dr. Stefan Kehraus
Institut für Pharmazeutische Mikrobiologie
E-mail: kehraus@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-5677
Raum 2.004
Nussallee 6
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Neue Antibiotika
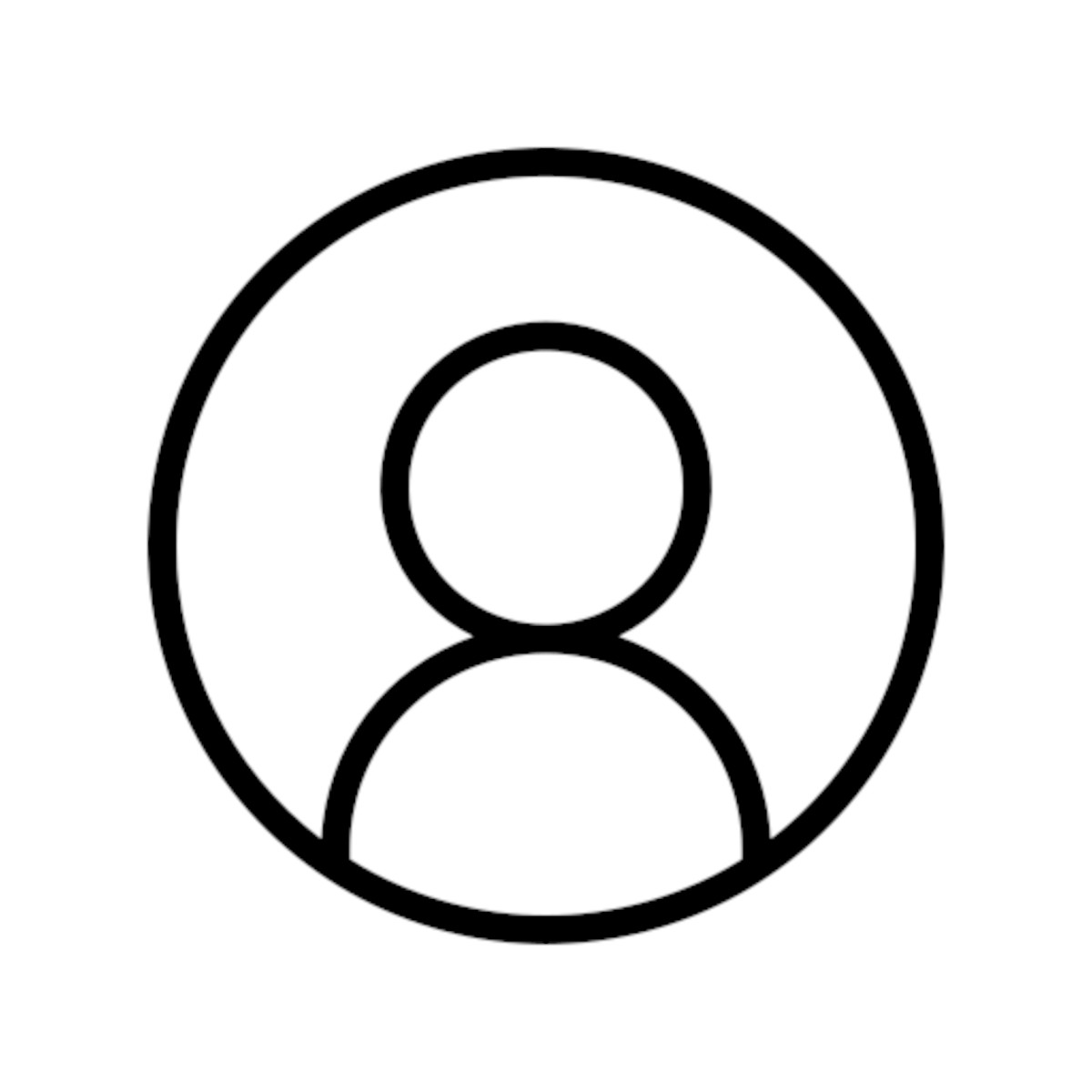
Prof. Dr. med. Thomas Kistemann
Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit (IHPH)
E-mail: thomas.kistemann@ukbonn.de
Tel.: +49 228 287-15534
Postadresse:
Meckenheimer Allee 166
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Leitung WHO Kollaborationszentrum für Wassermanagement und Risikokommunikation zur Förderung der Gesundheit.

Priv. Doz. Dr. Beate Kümmerer
Institut für Virologie
E-mail: Beate.Kuemmerer@virology-bonn.de
Tel.: +49 228 287-14468
Gebäude 63, 2. OG, Raum 27
Venusberg Campus 1
53127 Bonn
Unsere Gruppe befasst sich insbesondere mit Viren, die durch einen Insektenvektor auf den Menschen übertragen werden (Arboviren). Wir arbeiten hauptsächlich an Flaviviren und Alphaviren. Unsere wichtigsten Werkzeuge sind reverse Genetiksysteme, die es uns ermöglichen, rekombinante Viren in vitro zu produzieren. Mithilfe von molekularbiologischen, zellbiologischen, virologischen und biochemischen Techiken klären wir spezifische Funktionen viraler Proteine im viralen Lebenszyklus auf. Wir sind auch an der Virus-Wirt-Interaktion interessiert, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, das Zusammenspiel des Virus mit dem angeborenen Immunsystem von Vertebraten und Insekten zu analysieren. Darüber hinaus untersuchen wir die Aktivität potenzieller antiviraler Verbindungen und befassen uns mit zellulären Proteinen, die nachweislich die Virus-Replikation hemmen. Unsere reversen Genetiksysteme werden auch zur Entwicklung neuer Diagnostiktools verwendet, die in Impfstoff- und seroepidemiologischen Studien Anwendung finden. Mit diesen Studien tragen wir zur Entwicklung verbesserter Strategien zur Vorbeugung und Behandlung von Virusinfektionen bei.

Prof. Dr. Niels Lemmermann
Institut für Virologie
E-mail: Lemmermann@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 287-53445
Universitätsklinikum Bonn - Gebäude 65, EG
Venusberg - Campus 1
53127 Bonn
Forschungsgebiete: Herpesviren / Cytomegaloviren; virale Latenz; virale Immunmodulation; antivirale Immunantworten; Impfstoffe

Dr. Anna Müller
Institut für Pharmazeutische Mikrobiologie
E-mail: anna.mueller@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-4588
Raum 1.001
Meckenheimer Allee 168
53115 Bonn
Die bakterielle Zellwandbiosynthese bietet hervorragende Angriffspunkte für die antibakterielle Therapie. Sowohl Proteine als auch Biosyntheseintermediate sind Zielstrukturen für eine Vielzahl von antibiotisch wirksamen Substanzen. Diese sind meist essenziell für den Aufbau einer funktionalen Zellwand und oft sind keine homologen Strukturen im Menschen vorhanden. Neben Peptidoglykan, Wand- und Lipoteichonsäuren sind auch Polysaccharidkapseln wichtiger Bestandteil der Zellhülle pathogener Bakterien. Die Biosynthesewege der verschiedenen Polymere bieten nicht nur Angriffspunkte für verschiedene Antibiotikaklassen, sondern auch für Pathoblocker und Antivirulenz-Strategien. Die Identifizierung von Zielstrukturen und das molekulare Verständnis des Wirkmechanismus sind ein wichtiger Teil im Prozess der Weiterentwicklung von Substanzen für den Einsatz in der Klinik. Forschungsschwerpunkte sind die Untersuchung der Kapselbiosynthese in Streptococcus pneumoniae und die Regulation von Zellwandmetabolismus und -homöostase in Enterokokken.
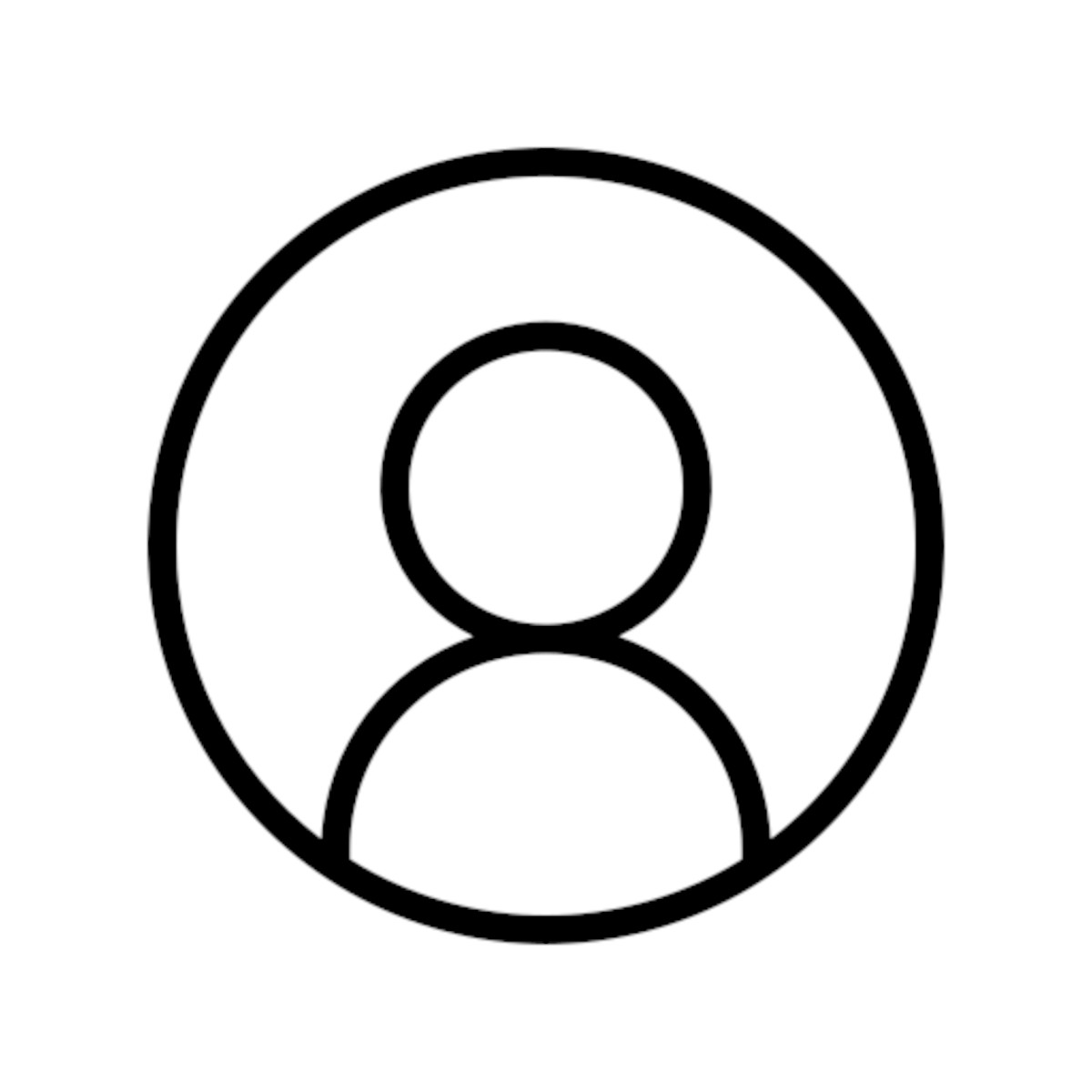
Dr. Cihan Papan
Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit
E-mail: cihan.papan@ukbonn.de
Tel.: +49 228 287-14639
Sigmund-Freud-Straße 25
53127 Bonn
Forschungsgebiet: Antibiotikaresistenz (Entstehung und Verbreitungswege). Umwelt-, Tier-, Krankenhaus- und Lebensmittelhygiene. Medizinische Mikrobiologie. Gesundheits- und Hygienemanagement. Public Health.

PhD Kenneth Pfarr
Institute of Medical Microbiology, Immunology and Parasitology
E-mail: kenneth.pfarr@ukbonn.de
Tel.: +49 228 287-11207
Gebäude 63, Raum 1G066
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn
Filarial nematodes that cause the human diseases lymphatic filariasis and onchocerciasis (river blindness), contain essential obligate endosymbionts in the genus Wolbachia. Wolbachia can be depleted from the nematodes with antibiotics and results in block in development of larvae and sterility and death in adult worms. Better understanding wolbachial cell wall biosynthesis and the molecular basis of the symbiosis can lead to identification of new compounds to treat these infections. One such candidate compound is corallopyronin A. My group is developing this compound to phase 1 trial in humans in collaboration with groups at the University of Bonn, Helmholtz Centre for Infection Research, and Eisai. We are also addressing corallopyronin A to treat Neisseria gonorrhoeae and Staphylococcus sp. Infections.

Dr. Manuel Ritter
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie (IMMIP)
E-mail: manuel.ritter@ukb.uni-bonn.de
Tel.: +49 228 287-11453
Universitätsklinikum Bonn - Gebäude 63
Venusberg - Campus 1
53127 Bonn
Forschungsgebiet: Immunologie von Filarieninfektionen mit Hilfe des Mausmodells Litomosoides sigmodontis, Epidemiologie und Immunologie von menschlichen Filariosen, Einfluss von Filarien auf Begleitinfektionen, Ursache und Immunologie der geochemischen Krankheit Podokonios

Prof. Dr. Tanja Schneider
Institut für Pharmazeutische Mikrobiologie
E-mail: tschneider@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-5688
Raum 1.005
Meckenheimer Allee 168
53115 Bonn
Forschungsschwerpunkte: Neue Antibiotika, Screening, Wirkmechanismus Analyse, Resistenzmechanismen, bakterielle Zellwandbiosynthese
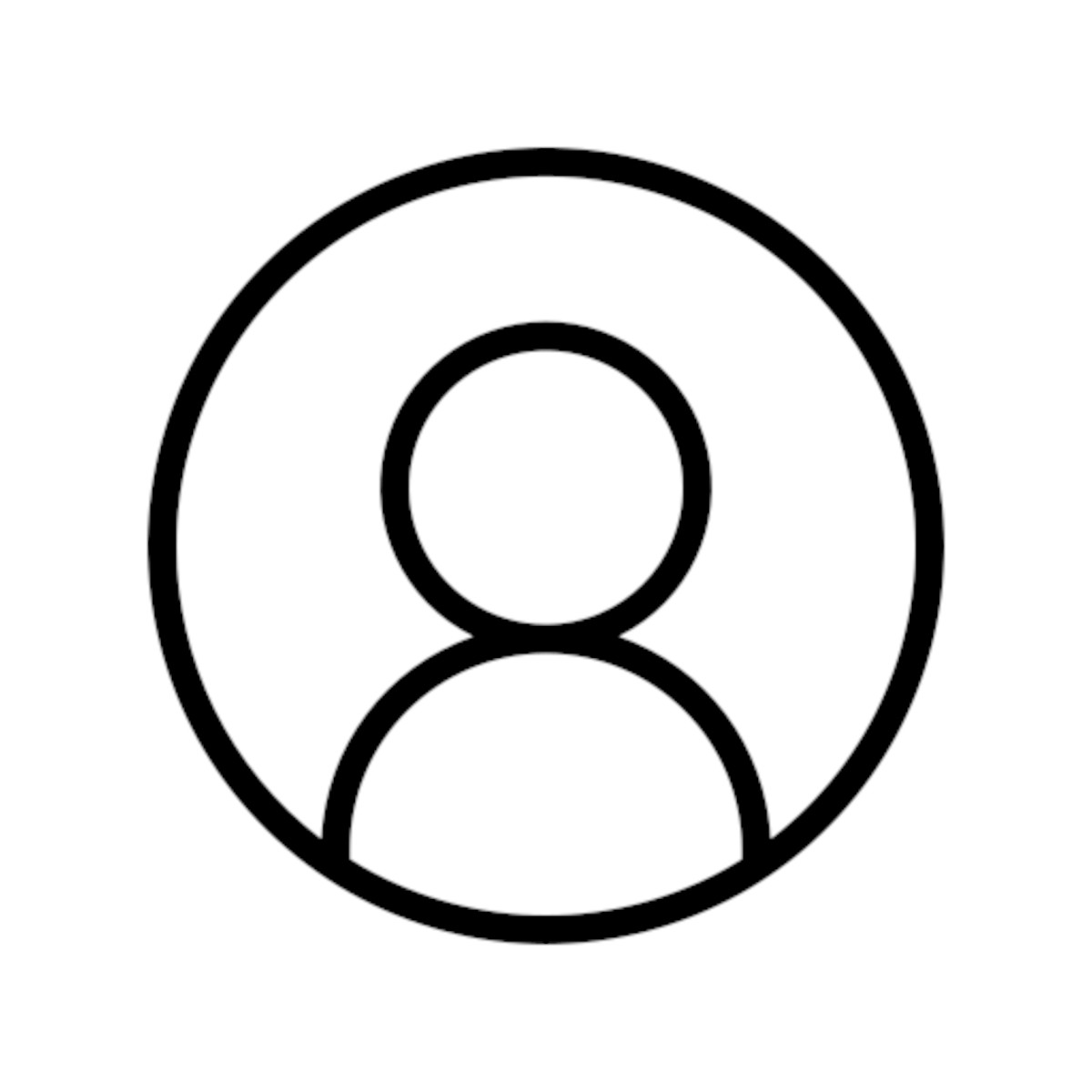
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. med. Christiane Schreiber
Institute of Hygiene & Public Health
E-mail: christiane.schreiber@ukbonn.de
Tel.: +49 228 287 14885
Universitätsklinikum Bonn - Gebäude 64
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn
- Pathogene
- Antibiotikaresistenzen
- Abwasserbehandlung
- Gewässermanagement
- Risk Assessment
- Technische (Trink-)Wassersysteme, Hausinstallationen
- Trinkwasserversorgung inkl. Einzugsgebiete & Aufbereitung
- WaterReuse
- Wasser in der Stadt / Stadtblau
- Einflüsse durch Klimawandel

Dr. Dominic Winter
Institut für Biochemie und Molekularbiologie
E-mail: dominic.winter@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-7081
Nussallee 10
53115 Bonn
Forschungsgebiet: Proteomik und Molekularbiologie zum Verständnis des Lysosoms.
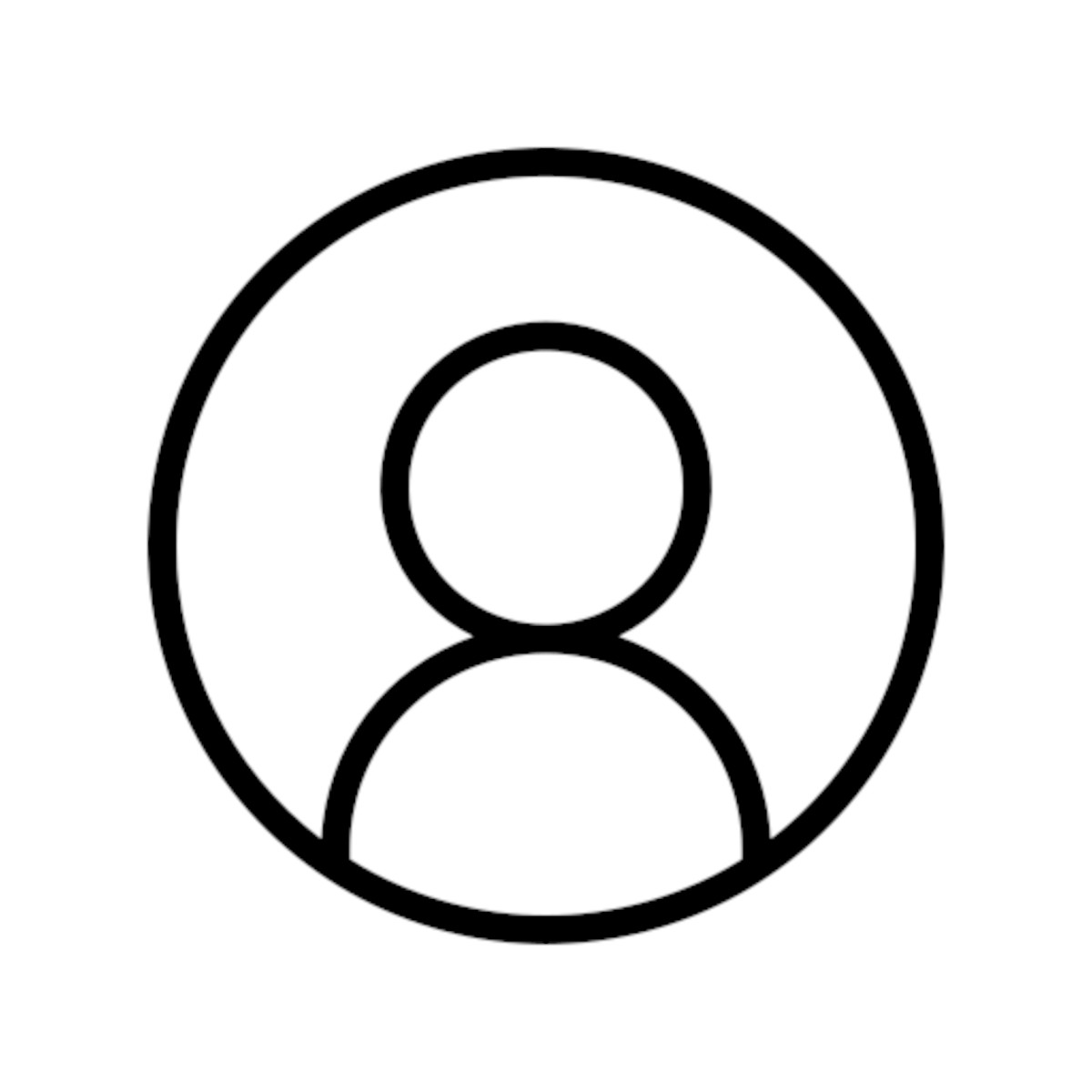
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Jochen Winter
Abteilung für Parodontologie, Operative und Präventive Zahnheilkunde
E-mail: jochen.winter@ukbonn.de
Tel.: +49 228 287-22011
Universitätsklinikum Bonn
Welschnonnenstraße 17
53111 Bonn
Forschungsgebiet: Orale Mikrobiologie

Dr. Nicole Zacharias
Institut für Hygiene und Public Health
E-mail: nicole.zacharias@ukbonn.de
Tel.: +49 228 287-19874
Venusberg Campus 1
53115 Bonn
Der Fachbereich Umweltmikrobiologie ist ein Teilgebiet der angewandten Mikrobiologie, welcher die mikrobielle Population verschiedener Umweltkompartimente betrachtet. Dazu zählen Trinkwasser, Abwasser, Gewässer und andere mikrobielle Ökosysteme. In Kooperation mit diversen Forschungspartnern werden geographische und mikrobiologische Fragestellungen rund um die Themenkomplexe Abwasser, Oberflächengewässer und Trinkwasser untersucht.
Neben der praktischen Bearbeitung der Forschungsprojekte wird in unserem Labor für experimentelle Umweltmikrobiologie die Routineanalytik zur kulturellen Bestimmung von somatischen Coliphagen und die Bestimmung von Salmonella spp. in diversen Wässern für Kunden des Hygiene-Instituts durchgeführt.
Zu den Forschungsschwerpunkten der AG gehören Bewertung von Trinkwasserhygiene, Antibiotikaresistenzen im Abwasser und Oberflächengewässern, Wasserwiederverwendung in der Landwirtschaft, Abwassermonitoring auf SARS-CoV-2 und andere Erreger


